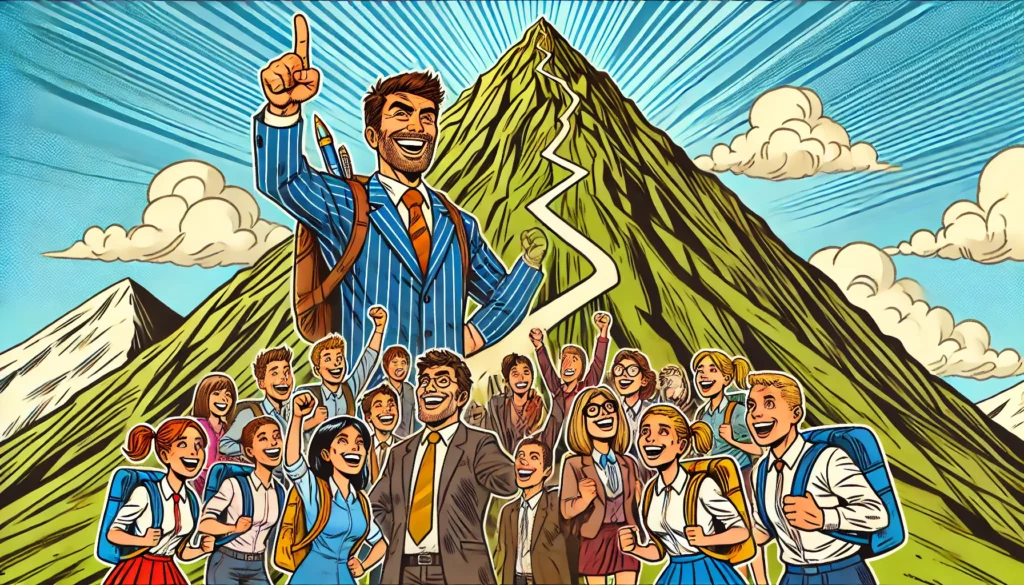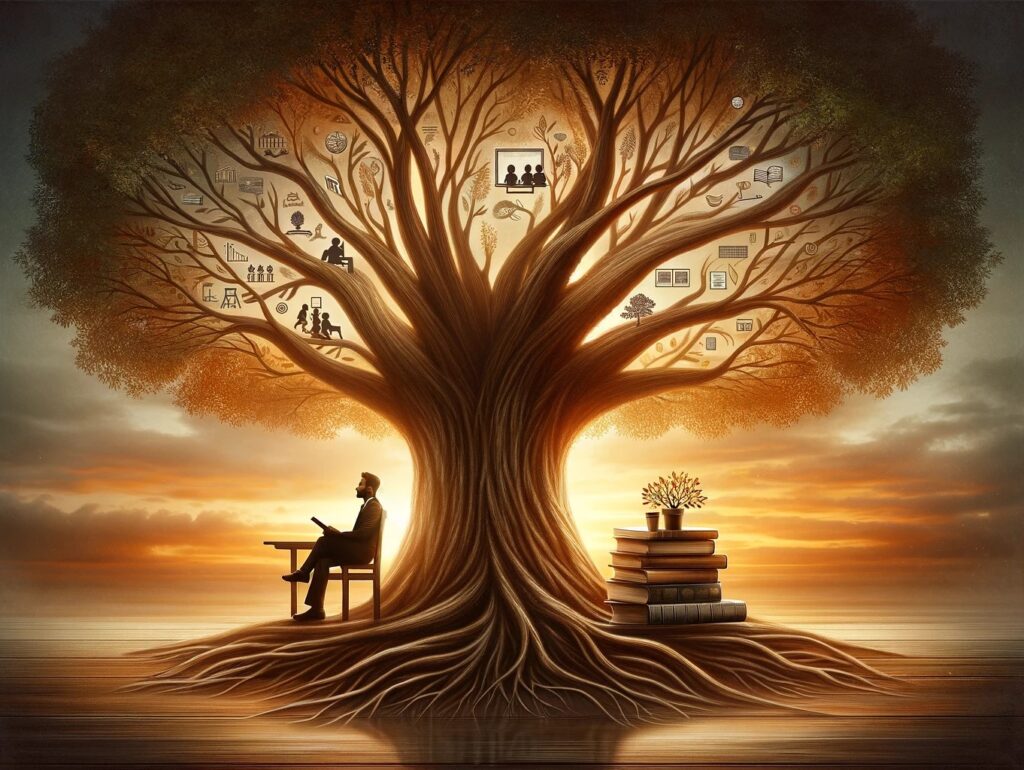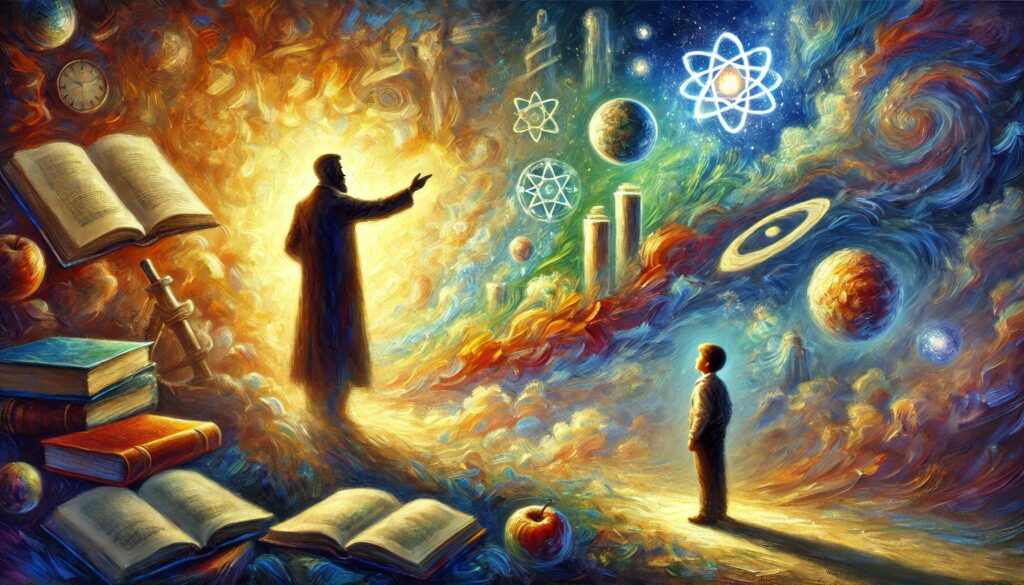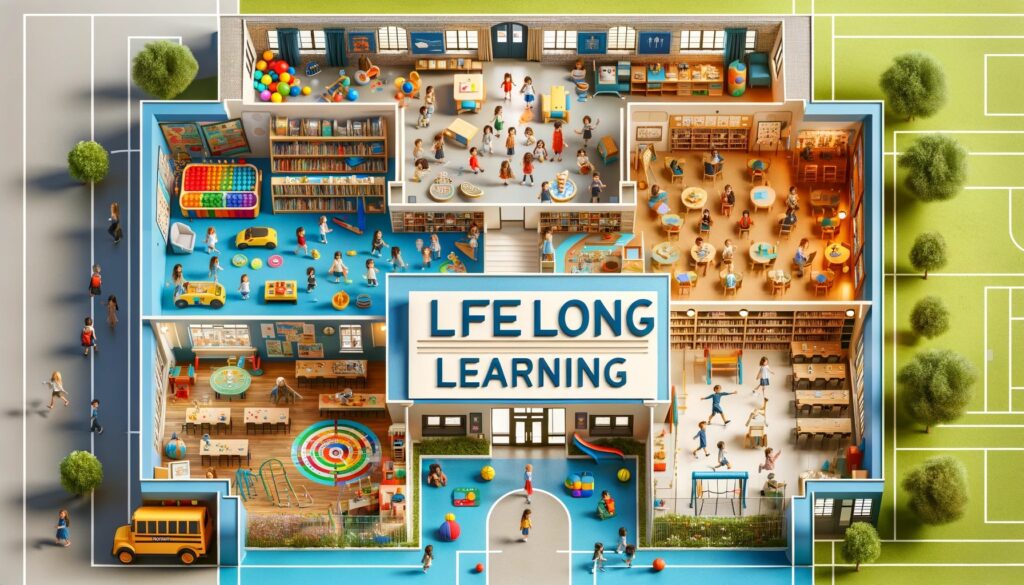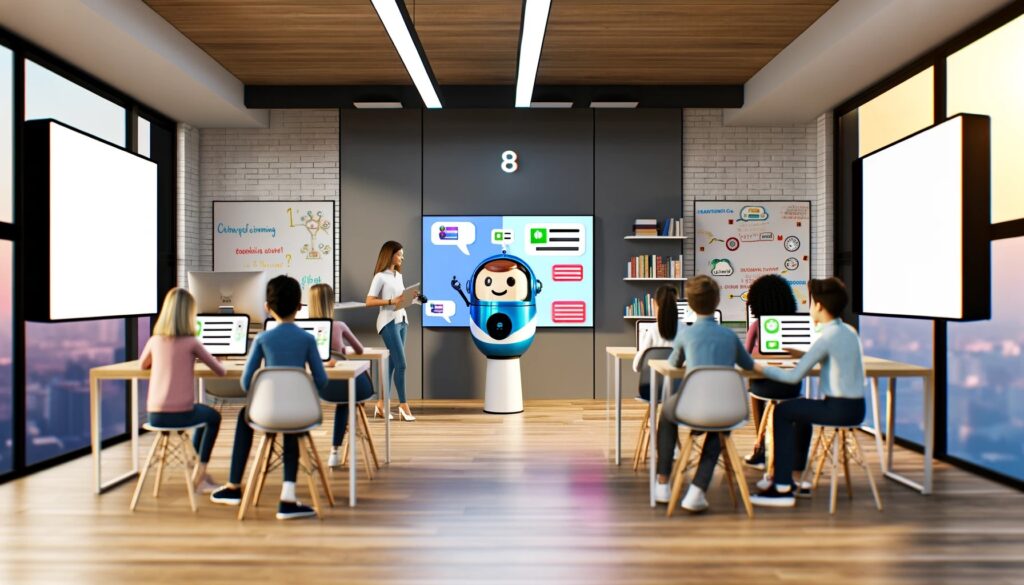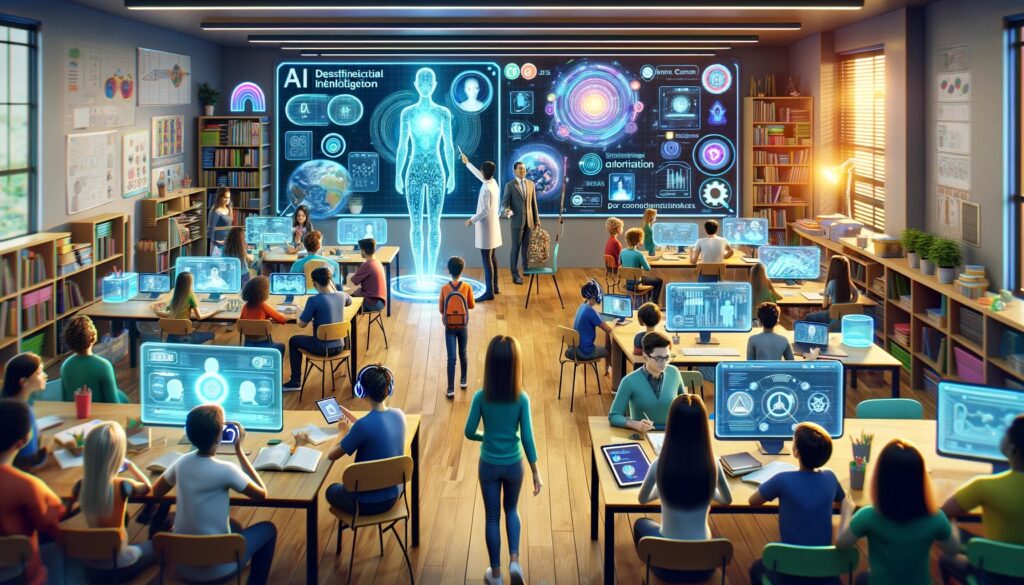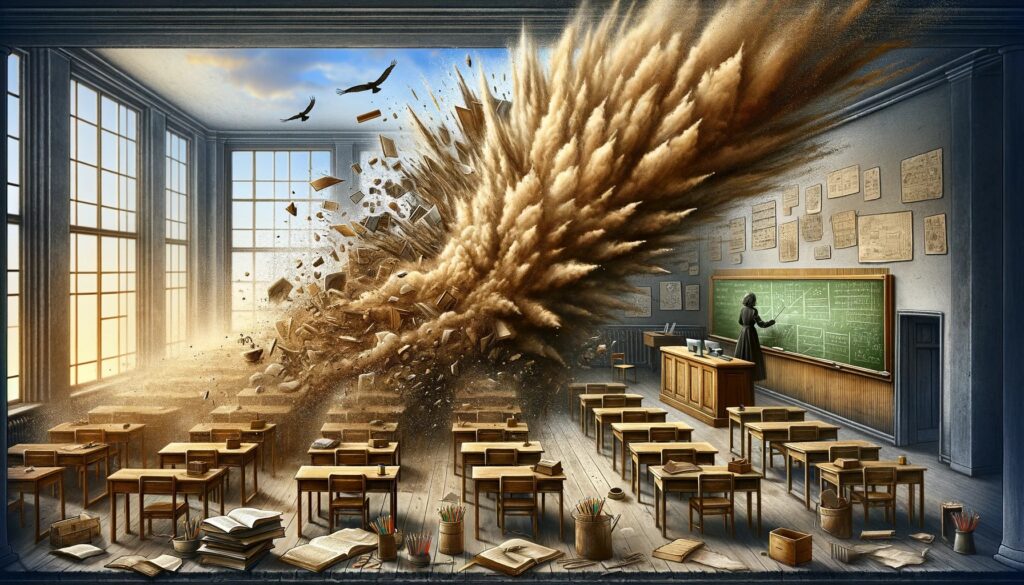Schule als „Dritter Ort“ und „School as a Service“
Ich durfte am 25. Mai 2024 bei einer Veranstaltung der Kinder- und Jugendfarm Dreieichhörnchen in Dreieich einen kleinen Impuls zum in der Überschrift genannten Thema einbringen. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit vor Vertreterinnen und Vertretern der Lokalpolitik zu sprechen, da ich so eines meiner Lieblingsthemen, kommunale Vernetzung für Bildung, einbringen konnte und ich hoffe, vielleicht einen initialen Funken gezündet zu haben, der in eine kommunal vernetzte Bildungslandschaft münden könnte.
Im Folgenden gebe ich den geplanten Vortrag wieder. Vor Ort bin ich gelegentlich vom Wortlaut abgewichen, um vorher Gesagtes aufzugreifen und flexibel zu agieren.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, aus den Vereinen und Verbänden, liebe „Hörnchen“ und alle sonst hier Versammelten,
mein Name ist Erik Grundmann und ich bin seit Beginn dieses Schuljahres der Schulleiter der Weibelfeldschule hier in Dreieich.
Vielen Dank für die Gelegenheit hier zu sprechen, ich freue mich, einen Impuls zum Thema Zukunft der Bildung in Dreieich beisteuern zu können.
Bitte verstehen Sie meine hier vorgetragenen Ideen nicht als fertiges Konzept, sondern als Denkanstöße. Wir brauchen für die Lösung der Probleme des 21. Jahrhunderts disruptive und agile Lösungen. Die Welt wird volatiler, unsicherer, komplexer und widersprüchlicher. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, brauchen wir neue Methoden, kreative Denkansätze, neue Arten von Kollaboration, Kommunikation und eine neue Art von Vernetzung.
Wir spüren glaube ich alle, dass unser Bildungssystem nicht mehr richtig funktioniert, das belegen die zahlreichen PISA, IGLU, IQB oder ifo-Studien und so weiter, die immer mal wieder kurz in den Medien aufflackern. Es scheint fast so, als hätten wir uns daran gewöhnt, das kann aber nicht unser Anspruch sein. Bildung ist unsere wichtigste Ressource für die Zukunft, wir können es uns nicht leisten, in allen internationalen Rankings immer schlechter zu werden. Ein Teil der Lösung kann sein, Bildung besser zu vernetzen, Schule zu einem integralen und mit außerschulischen Partnern vernetzten Teil einer Kommune zu machen und so mehr Selbstwirksamkeitserfahrungen für die Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen.
Ich bin deshalb hier, um über Lernorte, deren Vernetzung und deren Zukunft in Verbindung mit der Kommune zu sprechen. Ich will nicht über ideologisierte Schulformdebatten, den Fächerkanon oder ein überkommenes Verständnis von Unterricht sprechen, sondern über Lernorte in der Kommune.
Aktuell haben wir es mit einer Diffusion von Lernorten zu tun. Wir haben hier in Dreieich viele Orte zum Lernen, die in Teilen ansatzweise vernetzt sind, da ist aber sicher noch Luft nach oben. Die Schulen und frühkindlichen Bildungseinrichtungen sind eher geschlossene Institutionen, aus denen die Schülerinnen und Schüler selten rauskommen und in die nichtschulische Akteure zu selten reinkommen.
Allerdings findet die Diffusion der Lernräume auf mehreren Ebenen statt: Zu den realen und besonderen Lernorten, wie Schulen, Museen oder auch Kinder- und Jugendfarmen kommen zunehmend hybride und virtuelle Lernorte.
Mein Fokus als Schulleiter liegt naturgemäß auf dem Lernraum Schule, der sich lange Zeit selbst genug war. Es kann aber als erwiesen angenommen werden, dass außerschulische und unbewertete Lernorte für nachhaltigen Lernerfolg sorgen können.
1989 hat der amerikanische Soziologe Ray Oldenburg das Konzept des Dritten Ortes in einem Buch vorgestellt. Ihm ging es darum, neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz dritte Orte zu schaffen, die einen Ausgleich zu den beiden anderen bieten und ein Treffpunkt für die Kommune sein sollen. Diese Orte sollten für alle zugänglich sein, soziale Unterschiede nivellieren, Orte der Konversation und des Diskurses sein, gut angebunden sein und noch ein paar weitere Funktionen erfüllen. In den letzten Jahren wurde dieses Konzept häufig auf Büchereien übertragen und umgesetzt. Warum sollten aber nicht auch Schulen solche Dritte Orte sein?
Schulen bieten räumlich und strukturell ideale Voraussetzungen dafür, sie sind in der Regel gut erreichbar und ihre Aufgabe ist es ohnehin einen demokratischen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Diese Dritten Orte können übrigens auch virtuell oder hybrid dargestellt werden.
Der Gedanke der Schule und der Bibliothek oder auch anderer Orte als Dritte Orte lässt sich wunderbar mit dem Gedanken einer „School as a Service“ verbinden. Die Idee dahinter stammt von der Aalto-Universität in Otaniemi, einem Stadtteil von Espoo in Finnland, wo sich auch der „Prototyp“ befindet, und geht davon aus, dass die Attraktivität einer Gemeinde eng mit einer lokalen kulturellen Identität zusammenhängt, die wiederum eng mit Möglichkeiten zur Nutzerzentrierung und Ko-Kreativität durch die Bürgerinnen und Bürger zusammenhängt. Der Gedanke ist es daher kommunale Einrichtungen zu vernetzen und zu öffnen. Schule spielt dabei eine zentrale Rolle und nebenbei entstehen interessante Synergieeffekte, da Räume und Orte intensiver, multifunktionaler und damit effizienter genutzt werden.
Vereinfacht heißt das zum Beispiel, dass an einer weiterführenden Schule ein Makerspace mit Werkstatträumen besteht, die am Vormittag von der Schule genutzt werden, am Nachmittag in hybriden Formen mit Schülerinnen und Schülern und Menschen von außerhalb des Schulbetriebes, die dort Angebote unter anderem für Schülerinnen und Schüler machen. Und am Abend stehen die Möglichkeiten dort der ganzen Kommune zur Verfügung, z.B. als Repair-Cafe. Genauso nutzen die Schülerinnen und Schüler aber auch andere Orte und Gebäude der Gemeinde, zum Beispiel das Bürgerhaus für Musikproben, das Rathaus für Schülerratssitzungen, natürlich Sportgelände, das Haus des lebenslangen Lernens, Büchereien und Museen, vielleicht aber auch städtische Werkstätten und ganz sicher die Kinder- und Jugendfarm.
Da wir gerade hier sind, erlauben Sie mir noch ein paar Worte dazu, warum gerade die Dreieichhörnchen ein relevanter Lernort sind. Kinder- und Jugendfarmen bieten zwei Dinge, die Schulen so nicht bieten können, nämlich unmittelbare Begegnungen mit der Natur und freies Spiel, beides so wichtig in unserer immer stärker technisierten und urbanisierten Welt. Auch wenn wir an der Schule Umweltklassen mit Ackerbau haben und selbst wenn wir Bewertungen in den Hintergrund rücken, können wir aufgrund des rechtlichen Rahmens keinen Ort für so viel selbstwirksame freie und kreative Entfaltung für Kinder bieten, wie die „Hörnchen“. Gerade Schülerinnen und Schüler, die im Kontext von Schule vielleicht nicht so gute Erfahrungen machen, können hier Selbstwirksamkeit und Resonanz erfahren. Das freie Spiel hat einen unschätzbaren Wert für die Entfaltung von Zukunftskompetenzen und das soziale Lernen, dass es einen eigenen Vortrag wert wäre. Daher müssen Kinder- und Jugendfarmen und andere Orte zur Begegnung mit der Natur und zum freien Spiel integrale Bestandteile in modernen kommunalen Bildungsnetzwerken sein! Wenn ich könnte, wie ich will, würde ich jeden Tag einen Bus voll Kinder von der Weibelfeldschule hierher schicken!
Natürlich muss so ein Netzwerk organisiert werden, braucht eine digitale und analoge Infrastruktur und Personal, ich könnte mir aber vorstellen, dass sich das lohnt.
Bei dem beschriebenen Projekt in Finnland bildet die Haukilahti Secondary High School das Zentrum der „School as a Service“, den Hub, also die Organisationszentrale. Hier laufen die Fäden der Vernetzung zusammen.
Den Gedanken der Bildungshubs habe ich Anfang April in meinem Blog schon einmal weiter ausgeführt. Der Hub bündelt Kompetenzen und ist eine Organisationszentrale für ein kommunales Bildungsnetzwerk. Hier finden sich pädagogische, medizinische, therapeutische, technische und andere Expertinnen und Experten, die sich dezentralisiert nicht „lohnen“, genauso wie spezialisierte Orte, wie Werkstätten oder kulturelle Einrichtungen. Hier sind aber auch die anderen kommunalen Bildungs- und Nicht-Bildungseinrichtungen angedockt, die das Netzwerk in die Kommune tragen.
Lassen Sie uns die disruptiven Veränderungen, wie Klimawandel, Künstliche Intelligenz, demografischer Wandel usw., die das 21. Jahrhundert mit sich bringt und die Veränderungen im Bildungssystem, wie Digitalisierung, Erzieher- und Lehrkräftemangel, Bildung für nachhaltige Entwicklung, den Ganztag usw. zum Anlass nehmen, Bildung und Kommune neu zu denken und zukunftsfähig zu machen. Wir müssen uns neu ausrichten, wenn wir weiter ein schönes Leben führen wollen, wir müssen wieder enger zusammenrücken und Solidarität und Gemeinschaft pflegen. Und wo macht es mehr Sinn anzufangen als bei den Kindern und Jugendlichen?
Im Grunde gilt auch heute noch, auch wenn wir das vielleicht vergessen hatten, das afrikanische Sprichwort: Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf!
Hier gibt es die zugehörige Präsentation:
[Ein besonderer Dank geht an Michael Pallesche und die Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe für Inspirationen!]