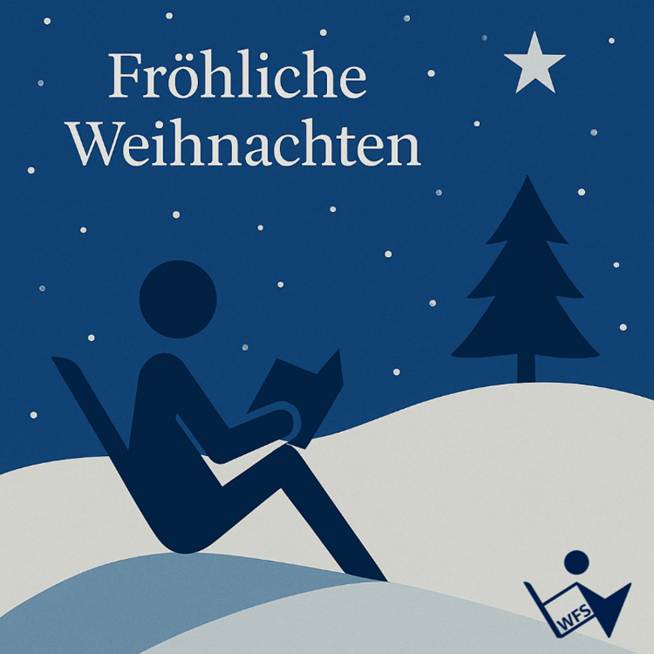Liebe Schulgemeinschaft,
dieser Newsletter erreicht Sie aus dem Schnee, als ich diese Zeilen schreibe, schneit es schon den ganzen Tag und ich sitze im Wintersport-Home-Office in Uttenheim in Südtirol.
Ich habe lange gezögert, ob ich mir es überhaupt erlauben kann an der Wintersportwoche unseres 8. Jahrgangs teilzunehmen, habe mich dann aber „überreden“ lassen und bereue es kein Stück.
Natürlich bleibt eine Menge Arbeit liegen, natürlich kann ich eine Menge Termine nicht wahrnehmen, natürlich fällt im LK Unterricht aus (gibt aber einen Arbeitsauftrag) und natürlich werde ich in den nächsten Wochen Liegengebliebenes aufarbeiten müssen. Aber das ist es wert. Außerhalb des unterrichtlichen Kontexts entsteht eine andere Welt. Für einige Schülerinnen und Schüler ist es die erste Erfahrung mit Urlaub in den Bergen, Schnee und Wintersport; für wenige ist es die erste Erfahrung mit Urlaub überhaupt und das zu beobachten erdet und erfreut zugleich. Es entsteht eine besondere Atmosphäre, man erlebt die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Kolleginnen und Kollegen in einem anderen Kontext. Es findet keine Bewertung statt, kein Zwang zum Unterricht in der Enge des Klassenraums im Takt der Schulstunde. Es gibt Freiheit, natürlich in einem pädagogisch angemessenen Rahmen.
Diese Freiheit wirkt. Sie schafft Vertrauen, ermöglicht Gespräche, die im Schulalltag oft keinen Raum finden, und sie lässt Beziehungen wachsen, die später auch im Unterricht tragen. Man teilt Erfolge und Misserfolge auf der Piste, lacht gemeinsam, tröstet, ermutigt, hilft sich gegenseitig. Schule wird hier ganz konkret als Lebensraum erfahrbar.
Gleichzeitig zeigt sich, wie wertvoll solche Fahrten für die Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler sind. Verantwortung füreinander, Durchhaltevermögen, das Überwinden eigener Grenzen, Rücksichtnahme und Gemeinschaft werden nicht theoretisch besprochen, sondern praktisch gelebt. Das sind Erfahrungen, die bleiben; oft länger als mancher Unterrichtsinhalt.
Auch für uns Lehrkräfte ist diese Woche ein Perspektivwechsel. Sie erinnert daran, warum wir diesen Beruf ergriffen haben, und daran, dass Bildung mehr ist als Stoffvermittlung, Noten und Abschlüsse. Sie ist Beziehung, Haltung und gemeinsames Erleben.
Zu dieser besonderen Woche gehören natürlich auch Konflikte. Wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, wo Müdigkeit, Kälte, ungewohnte Anforderungen und Emotionen aufeinandertreffen, bleibt Reibung nicht aus. Bei wenigen zeigt sich auch ein mangelndes Durchhaltevermögen, Frustrationstoleranz oder die Schwierigkeit, eigene Grenzen auszuhalten. Auch das ist Realität und kein Scheitern, sondern Teil eines Lernprozesses.
Gerade in diesen Momenten zeigt sich der pädagogische Wert solcher Fahrten. Konflikte werden nicht ausgeblendet, sondern begleitet, ausgehalten und so gut es geht gemeinsam gelöst. Schülerinnen und Schüler erfahren, dass Herausforderungen dazugehören, dass man nicht alles sofort können oder mögen muss und dass Unterstützung da ist, wenn es schwierig wird. Auch diese Erfahrungen sind prägend und wirken oft nachhaltiger als jede gut gemeinte Ermahnung im Klassenzimmer.
Mein Dank gilt daher allen Kolleginnen und Kollegen, die diese Fahrten mit großem Engagement ermöglichen, Verantwortung übernehmen und sich auf diese besondere Form von Schule einlassen. Ebenso danke ich den Eltern für ihr Vertrauen.
Ich werde mit müden Knochen, aber klarem Kopf, vielen Eindrücken und neuer Energie zurückkehren und ja, der Schreibtisch wird voll sein. Aber auch das gehört dazu und ist es wert.
Ihr
Erik Grundmann
Und hier wieder als Angebot, ein paar Links, Tipps und Empfehlungen, das naturgemäß nach den Ferien etwas ausführlicher ausfällt:
Interessantes
Silke Müller behauptet, das Schulsystem sei insolvent. Warum erklärt „News4Teachers“: https://www.news4teachers.de/2026/01/wir-sind-insolvent-warum-ex-schulleiterin-silke-mueller-das-deutsche-bildungssystem-fuer-bankrott-erklaert-und-ausgestiegen-ist/.
Susanne Posselt hat auf ihrer Website einen Vortrag von Andreas Schleicher zum Thema „Zukunftsschule 2041“ (aus Gewerkschaftsperspektive) zusammengefasst: https://susanneposselt.de/zukunftsschule-2041/.
Das „Deutsche Schulportal“ setzt sich kritisch mit dem Trend zu „Dark Romance-Literatur“ bei kritischen Jugendlichen auseinander, darüber sollten Lehrkräfte Bescheid wissen (Spannender Twist: TikTok(BookTok/Social-Media fördert Leselsut): https://deutsches-schulportal.de/schule-im-umfeld/dark-romance-im-jugendzimmer-was-lehrkraefte-jetzt-wissen-muessen/.
„Kappan“ beschäftigt sich mit Schumeln mit KI: KI-Schummeln ist kein völlig neues Problem, sondern eine neue Form eines alten Problems. Erfolgreiche Reaktionen brauchen klare Definitionen, gemeinsame Regeln, KI-Kompetenz und dialogische Schulentwicklung statt rein technischer Detektion oder Verbote. https://kappanonline.org/cheating-the-ai-elephant-in-the-classroom/ (auf Englisch).
JMS (Transparenzhinweis: Ich bin Mitglied) hat ein Impulspapier zu einem weltweiten Vergleich von Schulsystemen in Bezug auf die Vermittlung von Nachrichten- und Informationskompetenz veröffentlicht: https://journalismus-macht-schule.org/wp-content/uploads/2026/01/Impulspapier-JmS-1.pdf.
Wer sich mit Growth Mindset in der Schule beschäftigt, sollte mal auf diese Seite von Martin Karacsony, Ruth Stocker und Falk Szyba schauen: https://bildungsspirit.de/index.html.
Der LehrLernKompass von Uta Hauck-Thum und Micha Pallesche (OER, CC BY-NC 4.0) ist ein Assistent in CHatGPT und unterstützt Lehrkräfte dabei, Lehren und Lernen gemeinsam weiterzuentwickeln. Im Fokus stehen Lernsettings, die Basiskompetenzen sichern und zukunftsrelevantes Lernen ermöglichen: https://chatgpt.com/g/g-6968caf825d08191930942f34592bf61-lehrlernkompass.
Smartphone und Social-Media
Nachtrag zum Schwerpunktthema des letzten Newsletters: https://www.medienzeit-elternblog.de/blog/brainrot-stumpft-ab-roblox-echtes-problem.
Auch „netzpolitik.org“ setzt sich jetzt kritisch mit Roblox auseinander: https://netzpolitik.org/2026/gaming-plattform-roblox-gewalt-und-bauchfreie-oberteile/.
KI
Kritischer Artikel aus „Wired“ zu KI-Agenten: https://www.wired.com/story/ai-agents-math-doesnt-add-up/.
Pressemitteilung der TU-Berlin zu einer Studie über romantische Beziehungen zu Chat-Bots: https://www.tu.berlin/nachrichtendetails/ich-werde-ihn-nicht-aus-irgendeinem-grund-loeschen-ich-liebe-ihn.
RA Franziska Mauritz schreibt auf dem FelloFish Blog über rechtliche Leitplanken zum Einsatz von KI in der Schule: https://www.fellofish.com/blog/rechtliche-leitplanken-fuer-den-ki-einsatz.
Hauke Pöhlert plädiert für mehr Professionalität im Kontext von KI und Schule. Spoiler: Wir sehen im internationalen Vergleich in Sachen Teamwork, Regeldurchsetzung, Hospitationen, Fortbildung, Netzwerken nicht gut aus. Er macht 10 Vorschläge zur Professionalisierung: https://unterrichten.digital/2026/01/30/fortbildung-professionalisierung-ki-schule/.
Einführung in das Vibe-Coding (programmieren mit KI) auf „lernsachen.blog“: https://lernsachen.blog/2026/01/23/vibe-coding-was-ist-das-und-kann-ich-das-auch/.
Andrea Buhl-Aigner („Smartphone-Coach“) bloggt zum Thema KI-Councelling (ein zunehmendes Phänomen, vgl. letzter Newsletter) bei Kindern über Social Media, zum Beispiel WhatsApp: https://www.smartphonecoach.org/fragt-dein-kind-die-ki-um-rat/.
Manuel Flick hat eine „3×3-Modell“ für KI-resilientere Aufgaben entwickelt: https://www.manuelflick.de/blog/das-3×3-modell-fuer-ki-resilientere-aufgaben.
Die FR berichtet über den Trend, dass gute Arbeiten vermehrt unter KI-Generalverdacht stehen: https://www.fr.de/panorama/beaengstigend-entwicklung-an-deutschen-schulen-stellt-gute-schueler-unter-generalverdacht-zr-94135510.html.
Tipps für den Unterricht
Auf dem LernSachen-Blog gibt es eine Silben-Lesehilfe, die Silben in Texten automatisch einfärbt, mit Bildern versieht oder vorliest: https://lernsachen.blog/2026/01/20/silben-lesehilfe-silbenfarbung-und-wortbilder-per-klick/.
(Nicht nur) Für den Geschichtsunterricht gibt es unter https://shoahstories.video/de/ kuratierte Kurzvideos, produziert von Gedenkstätten und Zeitzeugen, zum Holocaust.
(Könnte auch unter „KI“ stehen, tut es aber nicht) Tolles Material zu KI für die Unterrichtspraxis von „Klicksafe“: https://www.klicksafe.de/materialien/ki-and-me-wie-kuenstliche-intelligenz-unser-leben-praegt.
Dr. Johannes Hellenbrand hat für Telli den KI‑Lernbegleiter für selbstreguliertes Lernen (SRL) Sid erstellt, hier gibt es die nötigen Informationen zur Einrichtung: https://github.com/drjhellenbrand/sid.
Leseempfehlung
Dieses Buch hat mir Sjef Drummen von der Agora-Schule in Roermond empfohlen und ich empfehle es gerne weiter: Rutger Bregmann: Im Grunde gut; Eine neue Geschichte der Menschheit, Hamburg 2025. Bregmann legt überzeugend dar, warum der Mensch eher nicht dem Hobbesschen Weltbild entspricht und nicht des Menschen Wolf ist, sondern eher hilfsbereit und kooperativ, eben im Grunde gut ist.
Hörempfehlung
Podcast des SR mit Silke Müller zu ihrem neuen Buch: https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:38f10bc4efd8d5a7/.
Der KI-Podcast der ARD geht der Frage nach „Woran hakt die KI-Revolution in den Schulen?“: https://podcasts.apple.com/de/podcast/woran-hakt-die-ki-revolution-in-den-schulen/id1698961192?i=1000739223328.
Sehempfehlung
Ich bin auf eine Playlist mit Videos von und zu Ken Robinson gestoßen, dessen Erkenntnisse und Beiträge zur Bildung unvergessen und inspirierend sind: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8A48D7DAFBAF140A.
Veranstaltungsempfehlung
Am 25. Und 26. September findet wieder Vision@Schule an der Albert-Schweitzer-Schule in Wetzlar statt. Wie im vergangenen Jahr gibt es interessante Vorträge, Workshops und mehr rund um die zukunftsfähige Schule.
Und kurz vorher, am 23. September, natürlich Bob Blume im Bürgerhaus Dreieich.
Spaß im Netz
Heute gibt es mal einen Persönlichkeitstest anhand der Handschrift, natürlich reliabel, objektiv und valide wie eine Schulnote: https://r74n.com/mini/handwriting.