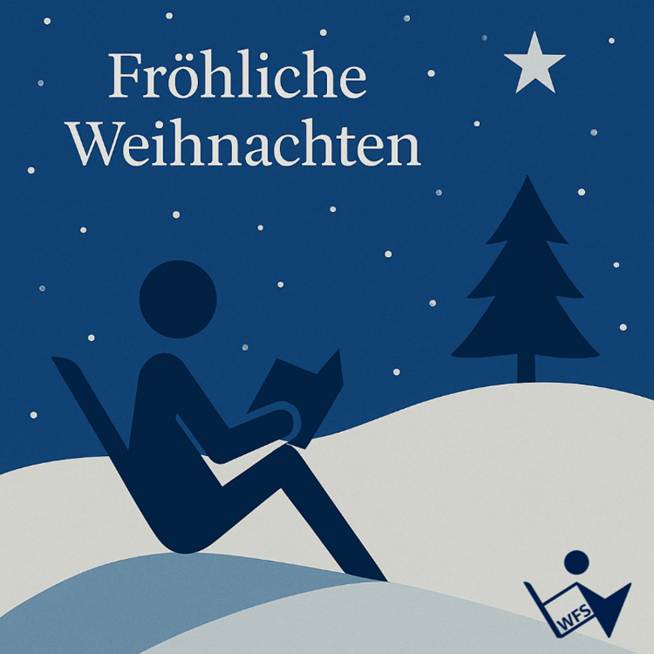Liebe Schulgemeinschaft,
es gab schon immer Trends, Codes und eine spezielle Sprache von Jugendlichen. Das ist kein Grund zur Sorge und dient auch der Distanzierung von anderen Generationen. Wenn ältere Generationen das adaptieren, wird es oft peinlich und das ist im Grunde auch unnötig.
Dennoch ist es wichtig, dass sich gerade Eltern und Lehrkräfte mit der Lebenswelt von Jugendlichen beschäftigen, nicht um diese vollständig zu verstehen und zu durchdringen, sondern um wenigstens ein Gefühl dafür zu bekommen, was Kinder und Jugendliche umtreibt. Das gilt für elektronische Spiele, vor allem aber für soziale Medien.
Soziale Medien sind definitiv integrale Bestandteil der Jugendkultur, sie dienen der Kommunikation und Vernetzung und sind damit auch ein Teil der Sozialisation in die Gesellschaft. Schließlich nutzen ja auch viele Erwachsene soziale Medien, um vernetzt zu bleiben, sich zu informieren oder zu amüsieren.
Es gibt aber auch die negative Seite. Neben der Polarisierung, der Spaltung und den Fakenews, die schon den Erwachsenen schwer zusetzen, sind Kinder und Jugendliche diesen Gefahren hilfloser ausgeliefert, da ihre Urteilskompetenz noch in der Entwicklung ist. Das nutzen Extremisten jeglicher Couleur aus. Das ist weitgehend bekannt und wird gelegentlich sogar in der Öffentlichkeit diskutiert.
Ich möchte in diesem Newsletter für etwas unbekanntere Phänomene sensibilisieren, von denen Eltern und Lehrkräfte zumindest wissen sollten.
Vermutlich haben einige schon von Jugendlichen gehört, die sich von TikTok zum Selbstmord haben inspirieren lassen oder von anderen Nutzern in den Tod getrieben wurde, wie zum Beispiel von dem Hamburger „White Tiger“, der einen 13jährigen Jungen in den USA dazu gebracht hat sich aufzuhängen. Es gibt in den sozialen Medien ganze Netzwerke, die sich damit brüsten andere zu Selbstverletzungen oder Selbstmord zu bringen (https://www.medienzeit-elternblog.de/blog/white-tiger-com-764-gefahr-kinder). Es gibt Handbücher in diesen Kreisen, in denen Manipulationstechniken erklärt werden und es gibt Foren und Chats in denen man sich austauscht. Das findet nicht nur auf TikTok statt, auch Discord, Telegram oder Roblox spielen dabei eine Rolle. Begehrte Opfer sind (psychisch labile) Teenager, weil diese in der Identitätsfindungsphase besonders vulnerabel sind.
Ein noch häufiger vorkommendes Phänomen sind Challenges, bei denen es eher zu unfallbedingten Todesfällen kommt, wie bei der 13jährigen aus Kassel, die bei der sogenannten Blackout-Challenge, inspiriert auf TikTok, zu Tode kam (https://www.hessenschau.de/panorama/blackout-challenge-auf-tiktok-13-jaehrige-aus-landkreis-kassel-stirbt-bei-mutprobe-v1,tod-nach-tiktok-blackout-challenge-100.html). Bei dieser Challenge geht es darum, durch kurzzeitiges Strangulieren kurz in Ohnmacht zu fallen. Andere Challenges fordern Deospray einzuatmen, Rasierklingen zu schlucken oder Waschmittel-Kapseln zu essen. Klicksafe hat dazu Informationen bereit gestellt: https://www.klicksafe.de/news/gefaehrliche-tiktok-challenges-das-muessen-eltern-und-lehrkraefte-jetzt-wissen. Auch das HMKB hat Informationen zusammengestellt: https://digitale-schule.hessen.de/digitale-kompetenzen/beratungsstelle-jugend-und-medien-hessen/online-challenges.
Neben diesen Challenges gibt es aber auch bestimmte Foren und Hashtags unter denen sich Jugendliche austauschen, zum Beispiel, wie bereits erwähnt, über Selbstmordmethoden oder aber auch zu Themen wie Abnehmen bis zur Magersucht. Triebkraft sind dabei oft Likes, also Anerkennung von anderen Nutzern und das Fehlen von Ansprechpersonen in der realen Welt. Unter anderem deshalb ist es so wichtig Vertrauensverhältnisse zu Kindern und Jugendlichen zu pflegen.
Andere Challenges haben eine sexuelle Konnotation, wie die Pantyhose-Challenge oder andere, bei denen Kinder und Jugendliche Videos veröffentlichen, in denen sie leicht bekleidet posieren oder tanzen. Die Konsequenzen für einen Vierjährigen aus einer anderen Challenge werden hier beschrieben: https://www.spiegel.de/netzwelt/oberbayern-vierjaehriger-veraetzt-sich-an-spuren-von-tiktok-experiment-a-842bbbb5-316f-4d48-a2b1-86148c20113e?sara_ref=re-so-app-sh. Aber nicht nur Challenges oder Foren bergen gefahren, auch die Algorithmen haben es in sich. Diese lernen ja aus dem Interesse der Nutzer und verstärken Inhalte mit großer Reichweite, welche oft polarisierend oder empörend sind, also zu Reaktionen animieren. Reaktionen und Interaktionen, clicks und likes sind die Währung in den sozialen Medien. Erreicht man hohe Aufrufzahlen für seine Inhalte, lassen sich diese zu Geld machen oder für manipulative Zwecke nutzen. Dies können extremistische Inhalte jeglicher Couleur sein oder auch Fakenews, die zur Destabilisierung der Gesellschaft beitragen. Ein weiteres Beispiel für solche Blasen, ist die so genannte „Manosphere“ (Hierhin gehören Andrew Tate oder der so genannte „Sigma-Boy“, verfilmt wurde das Phänomen in der Netflix-Serie „Adolescence“). Dort werden archaische Männlichkeitsbilder kultiviert und zur Unterdrückung von Frauen aufgerufen: https://taz.de/Umgang-mit-Maennlichkeitsbildern/!6132595/. Ein anderes Beispiel ist die „Tradwife-Szene“, dort werden traditionelle Frauenbilder gepflegt, also Frauen, die nicht arbeiten und den Haushalt führen und sich alleine um Kinder kümmern.
Lesenswert in diesem Zusammenhang ist das in einem früheren Newsletter schon einmal empfohlene Buch „Radikalisierungsmachinen“ von Julia Ebner (Berlin 2019). Eine weitere Leseempfehlung sind die beiden Bücher von Silke Müller zu dem Thema („Wir verlieren unsere Kinder“ und „Wer schützt unsere Kinder“).
KI hebt all dies noch einmal auf ein neues Level. Inhalte sind einfacher zu erstellen und Algorithmen lassen sich durch KI-Bots manipulieren, ganz zu schweigen von den Möglichkeiten für Mobbing durch Nudifier-Apps (Apps, die aus normalen Fotos Nacktbilder erzeugen). Kinder werden oft schon sehr früh in sozialen Medien mit extremer Gewalt oder Pornografie, egal ob KI-generiert oder echt, konfrontiert, solche Inhalte werden in den Feed gespült oder von anderen Nutzern geteilt oder sogar zufällig per Airdrop aufgefangen.
Ich möchte hier keine Panik machen. Soziale Medien haben viele positive Seiten, ich nutze sie auch gerne und intensiv. Sie sind eine zentrale Kommunikations- und Vernetzungsinstanz für Jugendliche. Es ist aber wichtig, dass Eltern und Lehrkräfte wissen, was in sozialen Medien passiert und möglich ist, um auf Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen vorbereitet zu sein. Das Schlechteste, was sie tun können, wenn ein Kind mit einer Horrorgeschichte aus den sozialen Medien zu Ihnen kommt, ist diese oder das Handy zu verbieten. Damit erreichen Sie nur, dass das Kind das nächste Mal nicht mehr kommt und mit seinen Erlebnissen dann alleine ist. Reden Sie, trösten Sie, bieten Sie einen Schutzraum, klären Sie auf, am besten präventiv und machen Sie ihr Kind stark, damit es sich auch im digitalen Raum wehren kann.
Ihr
Erik Grundmann
Aus aktuellem Anlass noch eine weitere Warnung. Aktuell werden von Jugendlichen zunehmend Zahnstocher mit Geschmack genutzt. Diese sind jedoch nicht alle harmlos, es gibt diese auch in Nikotin getränkt, teilweise in hoher Dosierung: https://www.apotheken-umschau.de/gesund-bleiben/rauchstopp/was-nikotinzahnstocher-so-gefaehrlich-macht-1455619.html.
Und hier wieder als Angebot, ein paar Links, Tipps und Empfehlungen, das naturgemäß nach den Ferien etwas ausführlicher ausfällt:
Interessantes
„News4Teachers“ beschäftigt sich mit der Lehrerarbeitszeit: https://www.news4teachers.de/2025/12/wie-viel-lehrkraefte-arbeiten-und-was-die-reine-unterrichtszeit-macht-nur-noch-ein-drittel-der-arbeitszeit-aus/.
Der SWR stellt eine Schule ohne Noten und Klassenarbeiten in Stuttgart vor: https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/schickhardt-gemeinschaftsschule-lernkonzept-pilot-schule-100.html.
Auf der Homepage der Zeitschrift „Eltern“ findet eine kritische Auseinandersetzung mit dem „Adult Only“-Trend statt: https://www.eltern.de/familie-urlaub/familienleben/-adult-only–trend–symptom-einer-gesellschaft–die-kinder-zum-stoerfaktor-erklaert-14046272.html.
„News4Teachers“ setzt sich kritisch mit dem „Startchancen-Programm“ auseinander. Spoiler: Zu viel Bürokratie, zu viel Top-Down und Intransparenz: https://www-news4teachers-de.cdn.ampproject.org/c/s/www.news4teachers.de/2025/12/schulleitungen-zum-startchancen-programm-geld-das-den-schulen-helfen-soll-blaeht-die-verwaltung-auf-und-fehlt-in-den-klassenzimmern/?amp=1.
Smartphone und Social-Media
Spannende Studienergebnisse zu Short-Videos auf TikTok. Spoiler: Diese haben einen negativen Einfluss auf die Erinnerungsfähigkeit: https://arxiv.org/pdf/2302.03714. (Siehe dazu auch die „Sehempfehlung“ zu „brain rot“)
Mini-Studie von „use the news“ zum Nutzungsverhalten Jugendlicher auf TikTok: https://www.usethenews.de/de/dokumente/tik-tok-studie-2025. Ein Kernergebnis: „Die Teilnehmenden wissen sehr wenig über die Sammlung und Verarbeitung von Informationen durch TikTok. Sie haben geringe Bedenken bei der Preisgabe personenbezogener Daten, aber mit steigendem Alter wächst das Verständnis für die Funktionsweise der Plattform.“
Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat eine Seite zu Desinformationen und Verschwörungstheorien erstellt: https://www.lass-dich-nicht-manipulieren.de/de?category=.
Metastudie zum „Brain-Drain“ durch Smartphones https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10525686/.
Der Standard beschreibt, wie vor allem Frauen mit Smart-Watches gegen ihren Willen gefilmt werden und diese Videos dann im Netz landen: https://www.derstandard.at/story/3000000303757/smart-brillen-werden-genutzt-um-videos-von-frauen-gegen-ihren-willen-ins-netz-zu-stellen.
KI
Interessanter Beschluss des Verwaltungsgerichts Hamburg zu einem Betrugsversuch mit KI bei einer Hausarbeit im Fach Englisch, die Beschwerde gegen die Wertung als Betrugsversuch wird abgelehnt: https://justiz.hamburg.de/resource/blob/1128534/4a02d061e1d2a47e4ff1449241831117/2-e-8786-25-beschluss-vom-15-12-25-data.pdf.
Starke und fundamentale KI-Kritik von Cory Doctorow (sehr lang und auf Englisch): https://pluralistic.net/2025/12/05/pop-that-bubble/#u-washington.
Barbara Geyer, Professorin an der University of Applied Sciences Burgenland, hat ein tolles Padlet mit KI Tools für wissenschaftliches Arbeiten zusammengestellt: https://padlet.com/barbarageyer/ki-tools-f-r-wissenschaftliches-arbeiten-jrgdcpc7xajs66nx. Barbara Geyer hat auch einen lesenswerten Blog zu KI-Agenten geschrieben. Spoiler: KI-Agenten können Online-Kurse absolvieren, das Problem ist, dabei lernt man nichts: https://barbarageyer.substack.com/p/wenn-ki-agenten-fur-uns-lernen.
„ars Technica“ berichtet, wie OpenAI Informationen in einem Selbstmord-Fall unterdrückt: https://arstechnica.com/tech-policy/2025/12/openai-refuses-to-say-where-chatgpt-logs-go-when-users-die/.
Im FelloFish-Blog schreibt die Rechtsanwältin Franziska Mauritz zum KI-Einsatz in Schulen: https://www.fellofish.com/blog/rechtliche-leitplanken-fuer-den-ki-einsatz.
Auch die DKJS hat ein Papier zu KI-Anwendungen in Schulen veröffentlicht, hier geht es um den Schwerpunkt Leistungsbewertung: https://www.dkjs.de/publikation/einsatz-von-ki-anwendungen-fuer-die-leistungsbewertung-an-schulen/.
Die OECD hat einen Report zur Effektivität von KI-Nutzung im Unterricht veröffentlicht: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-digital-education-outlook-2026_062a7394-en.html. Eine knappe Zusammenfassung gibt es hier: https://theeconomyofmeaning.com/2026/01/21/after-the-warnings-when-ai-in-education-can-work-possibly/.
Tipps für den Unterricht
Zwei Lehrerinnen aus Belgien berichten in der „Frankfurter Rundschau“ über ihre Strategien bei herausfordernden Lernenden: https://www.fr.de/panorama/strategien-koennten-altmodisch-erscheinen-lehrerin-mit-klarer-ansage-an-schueler-zr-94102480.html?. Klaus Hurrelmann spricht in einem Interview des „Deutschen Schulportals“ über Lernchancen in der Pubertät: https://deutsches-schulportal.de/schulkultur/klaus-hurrelmann-warum-die-pubertaet-so-viele-chancen-bietet-und-wie-schule-sie-besser-nutzt/.
(Schlechtes) Feedback Teil 2 auf dem FelloFish-Blog von Hendrik Haverkamp: https://www.fellofish.com/blog/richtig-schlechtes-feedback.
„WARUM … SOL, autonomes Lernen und Agilität nicht ausreichen“ von „Die Lernbegleiterin“: https://dielernbegleiterin.substack.com/p/warum-sol-autonomes-lernen-und-agilitat.
Leseempfehlung
Anders Indset: Das infizierte Denken, Berlin 2021. Der sich selbst als „Wirtschaftsphilosoph“ bezeichnende Indset, ehemaliger Handballprofi, Autor und erfolgreicher Unternehmer, analysiert unsere Gesellschaft und entwirft Szenarien für eine bessere Welt, indem wir unser Denken wieder auf wesentliche Aspekte richten. Keine leichte Kost, aber sehr
(er-)kenntnisreich.
Hörempfehlung
Schwieriges Thema und deshalb erst recht eine Hörempfehlung, der „Israel-Palästine-Podcast“ mit mittlerweile über 50 Folgen von fünf Schülerinnen und Schülern aus Berlin-Neukölln mit zahlreichen Experten als Gästen: https://www.katholische-akademie-berlin.de/veranstaltungen/veranstaltungsreihen/berliner-oberstufenforum/israel-palestine-podcast/.
Der Podcast „Potenzialverstärker“ des SPIEGEL-Bildungsjournalisten Armin Himmelrath bietet interessante Gäste, im Dezember 2025 zum Beispiel Leonard Sommer: https://potenzialverstaerker.podigee.io/.
Die Keynote von Prof. Lewandowsky „Fake News erkennen ist zu wenig: Welche Medienkompetenzen Schüler:innen lernen müssen“ vom letzten Netzwerktreffen von „Journalismus macht Schule“ ist hörenswert: https://open.spotify.com/episode/2KLKa22Q0YOW92Z2Cnweaa.
Sehempfehlung
Aktuelle Studienergebnisse zu „brain rot“ auf dem You-Tube-Kanal von „Howtown“: https://www.youtube.com/watch?v=tdIUMkXxtHg&t=909s.
Immer eine jährliche Sehempfehlung ist das „Sekundenglück-Video“ der ERS Karlsruhe: https://vimeo.com/1147913613/6fa19cb5df?share=copy.
Video von „Topfvollgold“ (Mats Schönauer). Hier wird auf die zunehmende Manipulation auf YouTube eingegangen: https://www.youtube.com/watch?v=FgVbNktCUzs.
Veranstaltungsempfehlung
Save the Date: Am 23. September 2026 kommt Bob Blume (https://bobblume.de/) ins Bürgerhaus Dreieich, weitere Informationen folgen.
Spaß im Netz
Wer die Hufe des Pferdes findet, bekommt den nächsten Newsletter gratis: http://endless.horse/.