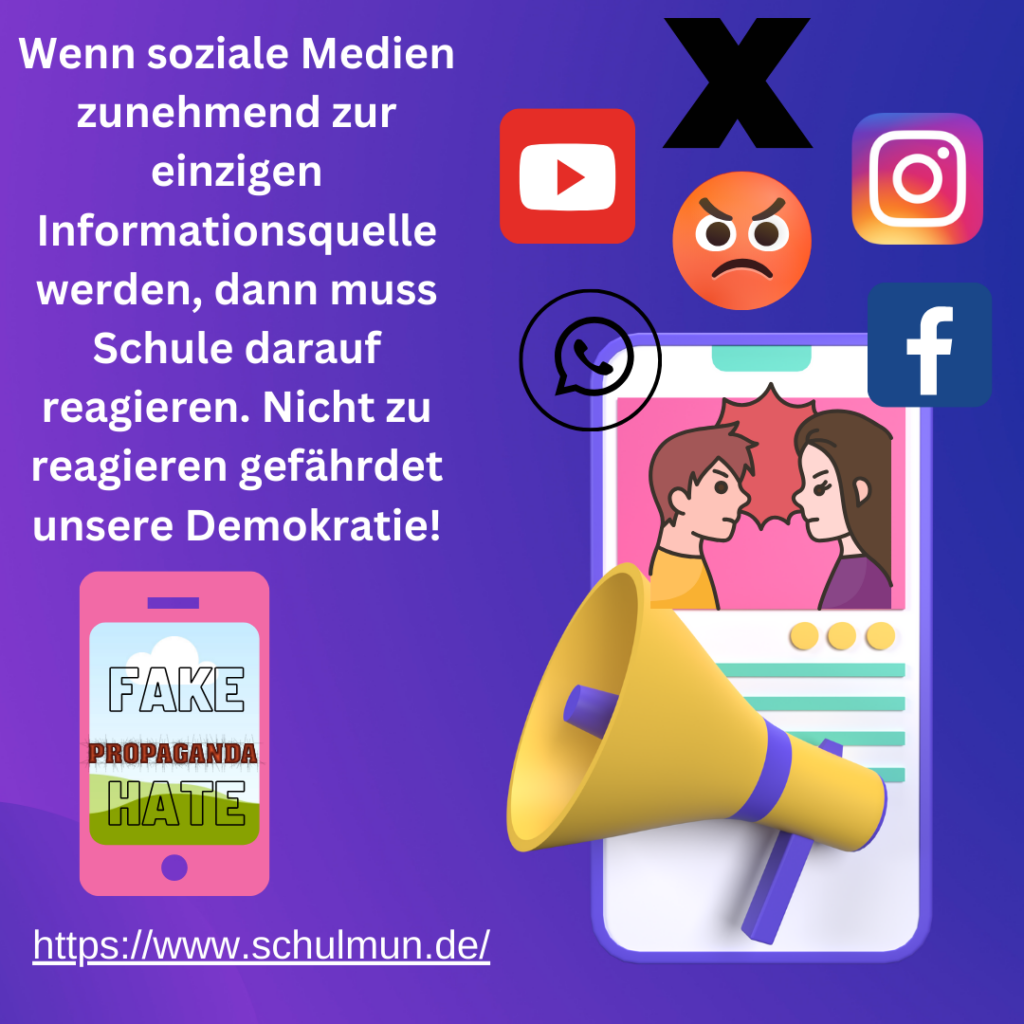2023 war in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Jahr. Ich möchte hier aus meiner ganz persönlichen und höchst subjektiven Sicht einen Blick auf dieses Jahr voller Wandel werfen. Dieser Wandel betraf mich und meine berufliche Situation, bezieht sich aber auch auf Entwicklungen, die weit darüber hinaus gehen. Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf Bildungsthemen, die mich Tag und Nacht umtreiben. Zunächst beschäftige ich mich mit den Themen, die die Bildungsrepublik bewegt haben. Am Ende werde ich dann auch etwas persönlicher und schreibe zu den Themen, die mich bewegt haben.
Zunächst war 2023 für mich das Jahr der Künstlichen Intelligenz. Natürlich gibt es das Thema schon deutlich länger, aber in diesem Jahr gab es erstaunliche Entwicklungen, die ich versucht habe mitzuverfolgen, was im Grunde kaum möglich war. Irgendwie war mir seit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 klar, dass das eine grundstürzende Entwicklung ist, die die Arbeitswelt umkrempeln wird. Aber nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch das Bildungssystem, das war spätestens klar, als mich Sal Khan mit seinem TED-Talk zu Khanmigo eines Abends Anfang Mai um den Schlaf gebracht hatte. Ein weiterer Schlüsselmoment für mich war die Anhörung zu KI im Bildungsausschuss des Bundestages am 26. April, in der Frau Professor Doris Weßels eine Taskforce zu KI auf höchster politischer Ebene und sofortige flächendeckende Fortbildungen für Lehrkräfte gefordert hat. Ich habe diese Anhörung mit meinen Klassen im Unterricht verfolgt und war einigermaßen verwundert, wie wenig entscheidende Vertreterinnen und Vertreter der Politik im Thema waren. Noch mehr verwundert hat mich, dass der Appell von Frau Weßels im Grunde bis heute ungehört blieb. Überhaupt zeigt das Thema KI noch einmal wie unter einem Brennglas einige Problembereiche im deutschen Bildungssystem. Es gibt kein bundesweites konzertiertes Vorgehen, einige Bundesländer haben Handreichungen geschrieben, so auch Hessen, andere haben Landeslizenzen für KI-Tools angeschafft, so Mecklenburg-Vorpommern oder erst kürzlich Rheinland-Pfalz. Es gibt einzelne Lehrkräfte oder Schulen, die sich intensiv mit den Chancen und Risiken von KI auseinandersetzen und ihre Schülerschaft darauf vorbereiten und es gibt viele Schulen und Lehrkräfte, die sich immer noch nicht im Ansatz damit beschäftigt haben. Diese Beliebigkeit vergrößert die ohnehin schon große Heterogenität im Bildungssystem und wird bei der rasanten Entwicklung im Bereich KI jeden Tag schwieriger wieder einzufangen. Und das, wo KI schon im Alltag der Schülerinnen und Schüler Einzug gehalten hat. Umfragen zeigen, dass sich immer mehr KI-Unterstützung für Hausaufgaben und Facharbeiten holen, ja sogar von KI-Assistenten (zum Beispiel auf Snapchat) beraten lassen. KI-Chatbots sind bei vielen Servicesystemen mittlerweile brauchbarer Standard und die sozialen Medien, aber auch die klassischen Nachrichtensysteme, werden zunehmend von KI generierten Bildern und Texten ergänzt. In der Summe bin ich der Ansicht, dass KI mehr Chancen als Risiken für das Bildungssystem birgt. Personalisierte KI-Tutoren können ein Teil der Lösung des Lehrkräftemangels sein und zu einer wünschenswerten Individualisierung von Lernprozessen beitragen. KI-Feedback- und Unterstützungssysteme schaffen ebenso ungeahnte Möglichkeiten und nicht zuletzt wird Schule durch KI wieder anspruchsvoller, weil die Ansprüche an die Leistungen der Schülerinnen und Schüler weiter steigen, wie es im Endeffekt durch das Internet ja auch der Fall war. Zahlreiche Links zur Entwicklung und zu Möglichkeiten von KI finden sich in der Rubrik Newsletter oder unter Links auf dieser Homepage.
Gleichzeitig bleiben natürlich zahlreiche offene Fragen:
- Wird es gelingen durch individualisierte KI-Copiloten die Heterogenität im Bildungssystem zu verringern oder wird diese eher größer, weil es nicht gelingt allen Schülerinnen und Schülern einen hochwertigen Zugang zu ermöglichen?
- Werden Methodik und Didaktik, aber auch Prüfungsformate an die neuen Möglichkeiten angepasst werden? (Verbote sind keine Option!)
- Wie können wir mit den zunehmenden (Deep-) Fakes von Bildern, Texten und Videos umgehen und welche Rolle spielt dabei Medienbildung an den Schulen?
- Wird es gelingen europäische KI-Modelle zu etablieren, die mit denen aus den USA mithalten können?
- Und natürlich die Fragen nach Datenschutz und Urheberrechten.
Gegen Jahresende machte dann mal wieder ein „PISA-Schock“ von sich reden. Da war aber schon fast eine andere interessante Studie in Vergessenheit geraten. Im Oktober war nämlich bereits der IQB-Bildungstrend 2022 veröffentlicht worden. Auch hier sind die Leistungen der deutschen Schülerinnen und Schüler in Klasse 9 in Deutsch und Mathematik wieder schlechter geworden. Bemerkenswert ist, dass die Leistungen in Englisch besser geworden sind. Spannenderweise lag das aber nicht an der Schule, sondern am Konsum englischsprachiger Medien. Ich lasse das an dieser Stelle unkommentiert. Zu PISA habe ich an anderer Stelle in diesem Blog schon einen Standpunkt entwickelt. Interessant, oder besser unerträglich, ist in diesem Zusammenhang allerdings die Tatsache, dass auch diese bildungswissenschaftliche Studie jeden Stakeholder in seiner noch so konträren Meinung zu bestärken scheint und am Ende, wie immer eigentlich, nichts passiert, sondern nach immer kürzerer Zeit wider „business as usual“ eintritt. Was mindestens getan werden müsste steht im Blog 2023-05 oder hier von „Mr. PISA“ Andreas Schleicher persönlich. Mir persönlich kommen die ganzen Bildungsstudien mittlerweile wie „Murmeltierstudien“ im Sinne des bekannten Filmes mit Bill Murray vor: Ein immer wiederkehrendes Ritual aus kurzer Empörung und darauf folgender Folgenlosigkeit.
Ein weiteres wichtiges Thema in der Bildungsrepublik war die Kultusministerkonferenz der Länder, kurz KMK. Nicht nur zwei Stellungnahmen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) der KMK zu Lehrkräftemangel und Lehrkräfteausbildung haben von sich reden gemacht, sondern auch eine Evaluation der KMK durch die Prognos AG, die ihr Ergebnis wie folgt zusammenfasst:
Aus der Analyse der Prozesse ergeben sich vor allem Impulse zur Verbesserung der Strategiefähigkeit der KMK, der Erhöhung der Bearbeitungsgeschwindigkeit sowie operative Fragen zur Verbesserung des Wissensmanagements, der Erhöhung der Effizienz und der Servicequalität. Quelle
Wie Hohn erschien vielen Kolleginnen und Kollegen die Empfehlung zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel der SWK der KMK aus dem Januar. Nicht nur, dass wieder viele verantwortliche Akteure so taten als seien sie von dem Mangel, den Bildungsforscher schon seit Jahren prognostizierten, überrascht worden, sondern auch die darin enthaltenen Empfehlungen wurden von vielen Kolleginnen und Kollegen als „Schlag ins Gesicht“ einer ohnehin überlasteten Berufsgruppe aufgefasst. So wurde als Lösungsmöglichkeit u.a. die „Erschließung von Beschäftigungsreserven“ vorgeschlagen, womit die Reduzierung von Teilzeit und von Abordnungen, eine Erhöhung des Renteneintrittsalters oder der Klassenfrequenzen (also Klassengrößen) gemeint waren. Manch Bundesland hat daraufhin ja tatsächlich das Unterrichtsdeputat erhöht. Weiter wurden die Beschäftigung von mehr Quer- und Seiteneinsteigern oder die Einführung von Hybridunterricht empfohlen. All diese Maßnahmen erscheinen auf den ersten Blick vielleicht sinnvoll, verschärfen meiner Meinung nach aber das Problem. Wer aufgrund mangelnder Kinderbetreuung oder persönlicher Überlastung sein Deputat reduziert, wird eher kündigen als Vollzeit arbeiten. Quereinsteiger belasten das System zunächst, da sie in den Job begleitet werden müssen.
Zur Entlastung der Lehrkräfte wurden dann noch Supervision, Achtsamkeits- und Kompetenztrainings zur Klassen- und Gesprächsführung empfohlen. Das kann man auch so lesen, als seien Lehrkräfte zu doof auf sich selbst zu achten und hätten keine Ahnung von Klassenführung.
Grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll und begrüßenswert, dass die KMK sich wissenschaftlich beraten lässt und sich ernsthaft mit dem Lehrkräftemangel befassen will und die Empfehlung der SWK enthält durchaus sinnvolle Ansätze, es ist aber nicht sinnvoll solche Vorschläge von einem „Elfenbeinturm“ herab zu machen und die Praktikerinnen und Praktiker erst nicht hinreichend zu hören und dann vor den Kopf zu stoßen. Aber vertikale wertschätzende Kommunikation ist ja schon immer ein Problem im Bildungssystem.
Mit einem weiteren Gutachten hat die SWK das Jahr dann im Dezember abgeschlossen, nämlich dem zur Lehrkräftebildung. Auch hier wieder Ideen aus der Universität für ein System in der Praxis, welche sehr im bestehenden System verhaftet sind und wenig Innovationspotenzial zeigen. Über ein duales Lehramtsstudium wurde zum Beispiel gar nicht erst nachgedacht. Begründet wurde dies, wie ich in einer Onlineveranstaltung des „Bildungsrates von unten“ (die Stellungnahme des Bildungsrates dazu gibt es hier) zu hören bekam damit, dass es dazu keine Studien gäbe. Wie auch, wenn das ein wirklich neuer Ansatz ist? Insgesamt zeigt die KMK die mittlerweile in vielen Bereichen latenten Zeichen von föderaler Dysfunktionalität: Wahnsinnig viele Gremien, die nichts voneinander wissen, unzählige Schriftstücke produzieren und am Ende zahnlos sind, weil keine Einstimmigkeit zu erzielen ist.
Für das Jahresende bleibt noch der neue Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD in Hessen zu nennen. Bildung steht an erster Stelle, das ist ein gutes Zeichen und es scheint auch ein Wille zu erkennen zu sein, mehr Ressourcen ins Bildungssystem zu stecken. So sollen zum Beispiel 12.000 Lehrkräfte mehr eingestellt werden; es ist allerdings unklar, woher diese kommen sollen. Das Blockflötenangebot in den Grundschulen kann man vielleicht belächeln, es kann aber, genauso wie die flächendeckende Einführung von „Digitale Welt“, durchaus sinnvoll sein, wenn es gut umgesetzt und von qualifizierten Kräften durchgeführt wird. Ein Paradoxon im Vertrag will mir aber partout nicht einleuchten, nämlich wie mit der Beibehaltung des gegliederten Schulsystems, mit Sitzenbleiben und Notengebung, (mehr) Bildungsgerechtigkeit erreicht werden soll. Aber das wird die kommende Legislaturperiode ganz sicher zeigen.
Zwischen erschreckend und erheiternd waren in 2023 die verschiedenen Kampagnen der Bundesländer zur Lehrkräftegewinnung. Da waren die bemüht jugendsprachlichen Versuche aus Bayern, die zum sichi Flexen aufforderten oder das Plakat am Flughafen Stuttgart, welches suggeriert hat, dass wer seinen stressigen Job aufgibt im Lehramt sicher Entspannung fände und jetzt zuletzt Sachsen-Anhalt, das sich nicht zu schade war mit einem mit einer Katze kopulierenden Hund zu werben.
Das mag ja vielleicht auf den ersten Blick alles ganz witzig sein und sicher viele Kreative ordentlich beschäftigt haben und vermutlich auch eine Stange Geld gekostet haben, geht aber meiner Meinung nach völlig am Problem vorbei. Junge Menschen entscheiden sich doch nicht für ein Lehramtsstudium oder ältere für einen Quereinstieg, weil sie viel flexen wollen, einen ruhigen Job suchen oder lustigen Biounterricht machen wollen. Der Grund Lehrerin oder Lehrer zu werden, der „Unique Selling Point“, wenn man denn so will, ist doch die Erfüllung junge Menschen auf die Zukunft vorzubereiten, das erzeugt Selbstwirksamkeit und die Bereitschaft sich auch die Unbillen des Systems anzutun. Jede Lehrkraft kennt mindestens diese eine Schülerin, diesen einen Schüler, meist sogar viele, bei denen man einen Unterschied gemacht hat. Das ist es, was den Job wertvoll macht und das ist es, mit dem man meiner Meinung nach junge Menschen dazu bekommt, Lehrkraft werden zu wollen. Das und ein attraktiveres Arbeitsumfeld mit weniger Bürokratie, ordentlichen Arbeitsplätzen und so weiter.
Für mich persönlich war 2023 mit einer großen Veränderung verbunden. Ich hatte mich als Stellvertretender Schulleiter auf die Schulleiterposition meiner Schule in Dietzenbach beworben. Ich war seit meinem Referendariat an dieser Schule und in der Kommune gut vernetzt und wäre gerne dort geblieben. Dietzenbach ist eine Kommune mit einem hohen Migrationsanteil und einer sehr umtriebigen Bürgerschaft, die ich wirklich lieb gewonnen habe. Ich hatte begonnen gemeinsam mit der Stadt ein kommunales Bildungsnetzwerk mit den meisten relevanten Akteuren aufzubauen und eine Auftaktveranstaltung mit Margret Rasfeld organisiert und durchgeführt. Leider hatte mein Dienstherr andere Pläne und hat mich nicht für die Stelle ausgewählt.
In der Retrospektive muss ich jetzt allerdings sagen, zum Glück wurde ich nicht ausgewählt, parallel wurde nämlich die Schulleiterposition an der größten Schule des Kreises ausgeschrieben, einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, die weiter wächst und ein wirklich interessantes Profil hat. Also habe ich mich im Juni dort beworben und wurde sehr schnell ausgewählt und konnte schon nach den Sommerferien dort den Job als Schulleiter antreten, der mir seither sehr große Freude bereitet. Im Rückblick kann ich sagen, dass es stimmt, dass eine berufliche Veränderung persönlich meist gewinnbringend ist. So traurig ich war, Dietzenbach zu verlassen, so froh bin ich jetzt in Dreieich angekommen zu sein.
Erwähnenswert ist noch meine Reise nach Berlin zum PxP-Festival im Juni. Dort trafen sich viele zentrale Akteure der deutschen Bildungsreformbewegung und ich wurde in meinem Vorhaben bestärkt, innovative Schulentwicklung zu betreiben und mich weiter zu vernetzen. Apropos vernetzen, für mich war 2023 auch das Jahr des social Networking (Linktree). Im Februar/März habe ich begonnen im Twitter-Lehrerzimmer aktiv zu werden und habe die Vernetzung und den innovativen Austausch dort schätzen gelernt. Seit Mitte des Jahres bin ich dann auch auf Instagram aktiv geworden und in den Herbstferien habe ich diese Homepage gestartet. Nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk und dem Wandel zu X, bin ich mit einem großen Teil der Twitterlehrerzimmerbubble zu BlueSky gewechselt, wo ich mich eigentlich recht wohl fühle. Seit kurzem bin ich auch auf Threads aktiv, damit aber noch nicht wirklich warm geworden. Für mich sind diese sozialen Netzwerke eine fruchtbare Quelle der Inspiration und des Austauschs, unter anderem um all die Anregungen dort sortiert zu bekommen, habe ich diese Homepage gestaltet, um in den Newslettern und den Links all die Netzperlen zu sortieren und zu archivieren. Die geneigten Leserinnen und Leser können also sicher sein, dass der Content hier dynamisch bleibt und wächst.
Ach ja, seit ein paar Wochen bin ich auch bei DigitalSchoolStory aktiv. Eher passiv engagiert bin ich beim Bildungsrat von unten und bei UnlearnSchool. Außerdem bin ich seit diesem Jahr Gründungsmitglied beim Verein von Schule im Aufbruch. 2023 war also für mich wahrlich ein ereignisreiches Jahr.
Soziale Medien beschäftigen mich aber nicht nur zum persönlichen Austausch, sondern auch aus pädagogischer und soziologischer Perspektive und nicht zuletzt in meinem Alltag als Schulleiter. Ein Schlüsselerlebnis dazu und warum wir Lehrkräfte das Phänomen noch stärker in den Fokus nehmen müssen, beschreibe ich hier in meinem Blog.
Bleibt zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick auf das kommende Jahr 2024. Mein Plan ist natürlich, mein Engagement weiterzuführen und auszubauen. Ich will mich weiter für eine Bildungsreform und damit eine Schule des 21. Jahrhunderts einsetzen. Zentral sind dabei für mich die Etablierung einer echten Kultur der Digitalität und ein ganzheitlicher und demokratischer Schulentwicklungsprozess, der die ganze Schulgemeinschaft einbezieht. Daher setze ich mich weiter für einen offenen und breiten Diskurs zur Bildungspolitik und Schulentwicklung ein. Für mich ist klar, dass ein „weiter so“ nicht mehr zielführend sein kann. Wir haben es mit so vielen Herausforderungen zu tun. Neben Klimawandel, Populismus und Kriegen, scheinen der Lehrkräftemangel und die unzureichende Digitalisierung und Ausstattung der Schulen zwar nur ein kleines Übel zu sein. Aber als Geisteswissenschaftler weiß ich um die dahinter stehenden Interdependenzen. Nur eine gute und zeitgemäße Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen versetzt diese in die Lage, die Herausforderungen der Zukunft in den Griff zu bekommen. Und dafür kämpfe ich! Trotz alledem!